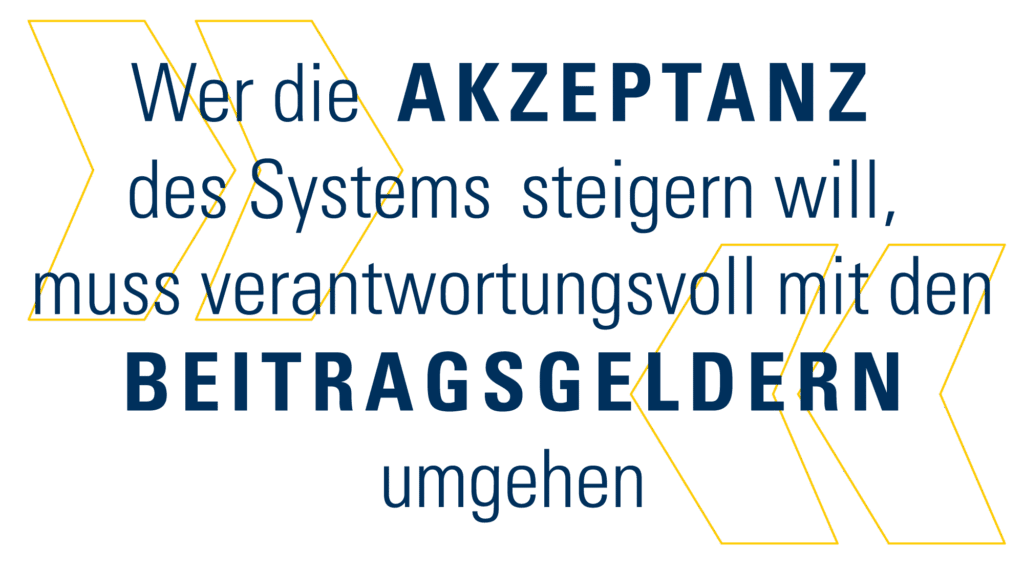
Interview mit den Vorsitzenden des Haupt- und Personalausschusses des BKK Landesverbandes Mitte

Rüdiger Dau
BKK Public, Vorsitzender des Haupt- und Personalausschusses 2024

Hans-Jürgen Lambert
Debeka BKK, stellvertretender Vorsitzender des Haupt- und Personalausschusses 2024
Die Medien berichten es regelmäßig: Der Gesetzlichen Krankenversicherung fehlt Geld, und die Zusatzbeiträge steigen. Das weiß auch die Politik, aber echte Reformen lassen auf sich warten. Wie schätzen Sie die Finanzlage der GKV ein?
Die Gesetzliche Krankenversicherung ist per se nicht unterfinanziert. 2024 hatten wir Beitragseinnahmen von 320 Milliarden Euro, so viel wie noch nie zuvor. Allerdings steigen auch die Ausgaben, und dies immer stärker als die Einnahmen nachziehen. Bei Ausgaben von 326,6 Milliarden Euro ergibt sich ein Minus von 6,6 Milliarden Euro. Dass dann die Kassen ihre Zusatzbeiträge erhöhen müssen, um ihre Versorgungsleistungen zu bezahlen, ist einfache Mathematik. Wenn man die Ausgaben in den Griff bekommen will, muss man die großen Probleme strukturell angehen.
Aus der Politik hört man immer wieder, die hohe Zahl an Krankenkassen würde mit zu den hohen Kosten beitragen.
1990 hatten wir in Deutschland etwa 1.600 gesetzliche Krankenkassen und einen durchschnittlichen Beitragssatz von 12,6 Prozent. Die Sozialabgaben lagen insgesamt bei 35,6 Prozent. Heute (2024) haben wir noch 94 Krankenkassen und Beitragssätze bis zu 19 Prozent. Und die 40-Prozent-Schallmauer der Sozialabgaben ist längst durchbrochen. Dabei liegen die reinen Verwaltungskosten etwa der Betriebskrankenkassen bei 4,3 Prozent netto. Die großen Kostenblöcke sind vielmehr die Krankenhausausgaben, die Medikamentenkosten und die Kosten für die niedergelassenen Ärzte.
Vor sechs Jahren hatten die Krankenkassen noch Rücklagen von 20 Milliarden Euro. Heute werden massiv die Zusatzbeiträge angehoben. Wie passt das zusammen?
Die Milliarden-Polster der Gesetzlichen Krankenversicherung sind längst Geschichte. Die Politik hat in den vergangenen zwei Legislaturperioden per Gesetz die Rücklagen der Krankenkassen auf ein gefährlich niedriges Minimum reduziert. Gefährlich deshalb, weil wir eine gewisse Mindestreserve brauchen, um auf Unwägbarkeiten reagieren zu können. Das hat uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Über 80 Krankenkassen mussten im vergangenen Jahr teilweise mehrfach ihre Beiträge nur deshalb anheben, um die gesetzliche Mindestreserve aufzufüllen. Den Rest hat dann die allgemeine Ausgabendynamik erledigt.
Aber wäre dann nicht eine breitere Einnahmenbasis sinnvoll, etwa wenn man die Beitragsbemessungsgrenze anhebt oder ganz aufheben würde?
Mehr Geld im System wird auf Dauer nicht gegen steigende Zusatzbeiträge helfen, wenn man nicht die Löcher auf der Ausgabenseite stopft. Die Politik hebt ja bereits jetzt jedes Jahr die Beitragsbemessungsgrenze an, und trotzdem laufen uns die Kosten weiter davon. Und die Bemessungsgrenze beizubehalten macht absolut Sinn, denn irgendwann würden unsere Mitglieder sonst Beiträge bezahlen, denen keinerlei Leistungen mehr gegenüberstehen. Höhere Beiträge machen ja nicht automatisch gesünder. Wer die Akzeptanz des Solidarsystems steigern will, muss verantwortungsvoll mit den Beitragsgeldern umgehen.
Welche Rolle kann denn die Kassenvielfalt dabei spielen?
Der Kassenwettbewerb ist die Grundlage für Fortschritt. Wer die Versorgung verbessern möchte, muss deshalb auch auf die Trägervielfalt achten. Das Werben um Mitglieder ist der Ansporn für die gesetzlichen Krankenkassen, die Versorgung zu verbessern. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Krankenkasse klein oder groß ist oder ob sie regional oder bundesweit agiert. Wichtig ist, dass sie die Interessen und Bedürfnisse ihrer Versicherten ernst nimmt. Tut sie das nicht, können unzufriedene Mitglieder die Krankenkasse wechseln. Dadurch entsteht ein gewisser Handlungsdruck, neue Versorgungskonzepte anzubieten und so Mitglieder zu binden oder hinzu zu gewinnen.
Welche Merkposten möchten Sie der Politik in das Hausaufgabenheft schreiben?
Zunächst einmal soll die Politik ihre offenen Rechnungen bezahlen. Die Pflegeversicherung wartet immer noch auf sechs Milliarden Euro für verauslagte Hilfsgelder aus der Corona-Pandemie. Der Gesetzlichen Krankenversicherung fehlen zehn Milliarden Euro an Einnahmen, weil der Bund für die Bürgergeld-Bezieher keine kostendeckenden Beiträge zahlt. Dabei bekommen sie die vollen Leistungen wie normale Beitragszahler. Wir müssen auch über verminderte Umsatzsteuer auf Arzneimittel reden. Für einen Cheeseburger „zum Mitnehmen“ wird ein ermäßigter Steuersatz erhoben, für Arzneimittel wird der volle Satz fällig. Das ist irgendwann nicht mehr vermittelbar.
Die Ampel-Koalition ist seit November 2024 Geschichte, und 2025 ist deshalb das Jahr der vorgezogenen Bundestagswahl. Welche Aufgaben muss die neue Bundesregierung als erstes angehen?
Im Grunde sind es die gleichen Aufgaben wie die der Vorgängerregierung: Wir brauchen endlich tragfähige Finanzierungskonzepte für die Kranken- und die Pflegeversicherung. Wenn man auf Dauer immer nur nach neuen Einnahmen sucht, um die wachsenden Ausgaben zu bedienen, wird das die Systeme an die Grenzen der Handlungsfähigkeit treiben. Und dann ist da noch die begonnene Krankenhausreform der Ampel-Koalition. Dieser Transformationsprozess wird mindestens die nächsten zehn Jahre dauern. Daran müssen sich alle Beteiligten, Krankenhäuser wie Krankenkassen, beteiligen. Sie müssen aber auch von der Politik gehört und mit eingebunden werden. Die Betriebskrankenkassen stehen dafür bereit.